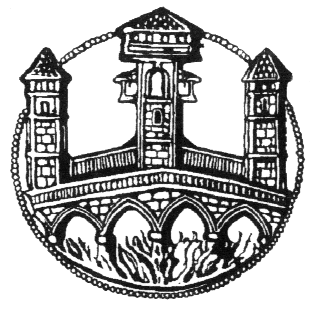 |
Die Rede von einem sogenannten "Großen Schisma im Jahr 1054" widerspricht eklatant der kirchengeschichtlichen Wahrheit |
|
Prof. Dr. Ernst Christoph Suttner, Wien
Einheit der Kirche in Vielfalt Alles Erkennen auf Erden nennt Paulus in 1 Kor 13,9f Stückwerk und schreibt, dass das Stückwerk erst vergeht, wenn das Vollendete kommt: wenn unsere Zeitlichkeit endet. Im Geist dieser paulinischen Worte bezeugte das 2. Vatikanische Konzil, dass die irdische Kirche für das angemessene Tradieren der geoffenbarten Wahrheit einer Mehrzahl von Frömmigkeits- und Erkenntnisentwürfen bedarf: "Das von den Aposteln überkommene Erbe ist in verschiedenen Formen und auf verschiedene Weise übernommen, und daher schon von Anfang an in der Kirche hier und dort verschieden ausgelegt worden …" (1) Denn die Kirche kann die Botschaft des Evangeliums nur dann in ganzer Fülle durch die Geschichte tragen, wenn sie in ihrer Gesamtheit die Frömmigkeits- und Erkenntnisentwürfe zusammenfasst, die ihr in den Einzelkirchen zuwachsen und von denen jeder für sich allein nur Stückwerk darstellt. Vielleicht lässt sich das "Zusammenfassen zur reicheren Erkenntnis der Gesamtkirche" durch einen Vergleich mit unserem räumlichen Sehen erläutern. Nachdem linkes und rechtes Auge dem Nervenzentrum gemeldet haben, was sie aus je verschiedenem Blickwinkel heraus flächig erfassen, erstellt das Zentrum als Synthese daraus das räumliche Bild. Die Notwendigkeit beider Blickwinkel für das volle Bild ersieht man leicht daran, dass einer, der durch einen Unfall ein Auge verloren hat, nur unvollkommen sieht und zum Beispiel beim Autofahren Schwierigkeiten hat. Wie das einzelne Auge darf auch jede einzelne Kirche bestimmte Aspekte erfassen. Sie darf das ihr Zugängliche in die Gesamtheit der Kirchen einbringen, und die Gesamtkirche kann durch das Zusammenwirken der Schwesterkirchen das Vollmaß geistlicher Erkenntnis erlangen und ihrerseits den Einzelkirchen, die mit ihr in lebendiger Gemeinschaft stehen, Anteil an der Einsicht der Schwesterkirchen vermitteln. Bis in die Zeit um das Konzil von Trient hielten sich die Kirchen an das, was eben aus dem Ökumenismusdekret des 2. Vatikanischen Konzils zitiert wurde. Neuerdings knüpfte das Vatikanum daran wieder an und bezeichnete unterschiedliche gottesdienstliche Gepflogenheiten, unterschiedliche spirituelle Formen, unterschiedliche kirchliche Rechtsordnungen und Unterschiede im theologischen Lehren als für die Kirche unerlässlich. Es erklärte, "dass das ganze geistliche und liturgische, disziplinäre und theologische Erbe (der östlichen und der westlichen Kirchen) mit seinen verschiedenen Traditionen zur vollen Katholizität und Apostolizität der Kirche gehört." (2) Ehrlicherweise ist diese Einsicht des Konzils "Wiederentdeckung" zu nennen, denn in der Neuzeit ist sie infolge der Erschütterung durch die Reformation (und vielleicht auch wegen des Aufkommens einer russischen Altgläubigenbewegung) der Christenheit mehr oder weniger "abhanden gekommen". Das "Abhanden-Kommen" hat eine lange Vorgeschichte. Schon in recht früher Zeit hätten die Christen am liebsten darauf verzichtet, sich durch Fremdes bereichern zu lassen. Sie fingen an, die Frömmigkeits- und Erkenntnisentwürfe, denen sie selber anhingen, für gottwohlgefälliger einzustufen als alles, was von anderen kam; manche meinten sogar, es wäre das Beste, wenn "die anderen" auf alles Eigene verzichteten und sich mit jenen geistlichen Gütern zufrieden gäben, die kennzeichnend sind für das bei ihnen, den Kritikern, übliche kirchliche Leben. Das wechselseitige Geben und Nehmen wurde zu gering, als dass alle noch voll an den Einsichten hätten partizipieren können, die der Geist den verschiedenen Kirchen gewährte. Anstatt weiterhin die vielerlei Erfahrungen zu einer "bereicherten Erkenntnis" zusammenzufassen, hätte man die Kirche lieber verarmen lassen wollen; man ließ sich kaum mehr beeindrucken durch geistliche Erfahrungen anderer und gebärdete sich einseitig genug, um ausschließlich das in der eigenen Kirchengemeinschaft Übliche als für die wahre Kirche angemessen gelten lassen zu wollen. Ein geraffter Überblick zu bezeichnenden Momenten der Kirchengeschichte soll im folgenden deutlich machen, dass sich die großen Konzilien bis einschließlich des Tridentinums dieser Tendenz widersetzten. Sie wurden jedoch zu wenig gehört. Doch zuvor noch eine knappe Überlegung zu den Schismen in der Kirche. Schismen in der Kirche Gemäß Apg. 4,32 müssten die Christen "ein Herz und eine Seele" sein. Dann gäbe es zwischen ihnen den vollen Austausch der Gaben. Doch die kirchliche Wirklichkeit liegt weit ab von dem Ideal, das die Apostelgeschichte zeichnet. Unstimmigkeiten unterschiedlichster Art und von recht verschiedenem Gewicht, die sich in der kirchlichen Realität gegen das biblische Ideal ergaben, nennt die Christenheit von alters her "Schisma". Was alles im Lauf der Kirchengeschichte als Schisma bezeichnet wurde, ist - wie ein genaues Studium erbringt - von recht unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Erst als im Abendland durch die Reformation und im Osten durch die Altgläubigenbewegung Schismen neuerer Art verursacht wurden, bei denen es nicht mehr um Verweigerung der Vervollkommnung durch Austausch mit Schwesterkirchen ging, sondern um Zweifel an der Treue der eigenen kirchlichen Überlieferung zu Christi Wort, und als diese Schismen die Aufmerksamkeit unserer Theologen und Hierarchen nahezu ausschließlich in Anspruch nahmen, setzte sich in unseren Kirchen fast völlige Blindheit und Taubheit gegenüber allen fremden geistlichen Erfahrungen durch, und unsere Kirchen vergaßen in Selbstgenügsamkeit auf die unumgängliche Voraussetzung für ihre Katholizität. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung erlangte im allgemeinen Bewusstsein der Gläubigen und bei kirchengeschichtlich weniger gut ausgebildeten Bischöfen und Priestern der Begriff "Schisma" die nämliche Bedeutung wie der Begriff "Glaubensspaltung", und der Mehrheit in unseren Kirchen ging das Bewusstsein verloren, dass "Schisma" nicht immer gleich "Schisma" ist, sondern Grenzlinien von recht unterschiedlicher Bedeutsamkeit meinen kann. Wann immer von "Schisma" die Rede ist, pflegt heutzutage die Mehrheit der Christen sofort an Kirchenspaltung und gegeneinander stehende Konfessionen zu denken. (3) Und so verfiel man auf den irrigen Gedanken, seit urvordenklichen Zeiten schon seien Lateiner und Griechen als "Katholiken" bzw. "Orthodoxe" zwei voneinander getrennte Kirchen. Das Verständnis vom Schisma Als die Bischöfe der Lateiner und der Griechen 1439 zum Konzil von Ferrara/Florenz zusammenkamen, waren sie der Meinung gewesen, dass ihre Kirchen zueinander im Schisma stünden. Doch das, was zu ihrer Zeit als Getrennt-Sein galt und was sie "Schisma" nannten, war von solcher Art, dass es die Hierarchen nicht hinderte, zum ökumenischen Konzil zusammenzutreten und ihre bischöfliche Verantwortung gemeinsam auszuüben. (4) Eine Beschreibung des Urteils der Lateiner über die Griechen, das - obgleich damals schon Jahrhunderte alt - recht gut umreißt, wie beide Seiten auch zur Zeit des Florentinums einander wechselseitig einschätzten, stammt von Bernhard von Clairvaux. Dieser stellte in einer seiner Schriften fest, dass die Griechen "mit uns sind und nicht mit uns sind, im Glauben (mit uns) vereint, im Frieden (von uns) getrennt, obgleich sie auch im Glauben von den rechten Wegen wegstolperten." ("Ego addo de pertinacia Graecorum, qui nobiscum sunt et nobiscum non sunt, iuncti fide, pace divisi, quamquam et in fide claudicaverint a semitis rectis.") (5) Trotz schwerer wechselseitiger Verunglimpfungen war es in den vorausgegangenen Jahrhunderten nie dazu gekommen, dass über die Lehre, über die Riten, über die Spiritualität oder über die Kirchenordnung der einen oder anderen Seite ein amtliches kirchliches Anathem verhängt worden wäre. Allerdings hatte es seit Jahrhunderten immer wieder Kontroverstheologen und Kirchenführer gegeben, die meinten, dass die Verschiedenheit zwischen den lateinischen und den griechischen Kirchen den Rahmen der Rechtgläubigkeit sprenge. Mochten jene, die so dachten, auch noch so zahlreich gewesen sein: Weder auf lateinischer noch auf griechischer Seite erlangten sie die autoritative Zustimmung ihrer Kirche. Es gab im Gegenteil, wie wir jetzt aufzeigen wollen, immer wieder bedeutsame Konzilsentscheidungen, welche ausdrücklich die Rechtgläubigkeit beider Seiten feststellten. 1) Das 4. Laterankonzil bezieht Stellung Auf lateinischer Seite hatte 1215 das 4. Laterankonzil im 4. Kapitel seines Beschlusstextes zwar gemeint, dass manches an der Überlieferung der Griechen für problematisch gehalten werden könne; (6) dennoch stimmte es zu, dass alle Besonderheiten im kirchlichen Erbe unverändert bleiben dürfen, wenn es unter gemeinsamen Bischöfen zu einer kirchlichen Vereinigung zwischen Griechen und Lateinern kommt. Diese Beschlussfassung bestätigte eine damals schon circa anderthalb Jahrhundert geübte Praxis der abendländischen Kirche. Denn die Normannen, die Lateiner waren, hatten, als sie Süditalien und Sizilien eroberten, die dortigen Kirchen der Griechen zwar für "schismatisch" gehalten; dennoch hatten sie voll anerkannt, dass die griechischen Kirchen dieselben heiligen Sakramente feierten wie die normannische Kirche. Trotz aller Skepsis gegenüber deren kirchlicher Tradition hielten sie es für angebracht, über Griechen und Normannen gemeinsame Bischöfe amtieren zu lassen. (7) Wo der Bischof Grieche war, wurde er dem römischen, nicht mehr dem konstantinopolitanischen Patriarchen unterstellt. Damit (und ohne dass bei ihm, bei seinem Klerus oder beim Volk ein Wandel im Glaubens- und Frömmigkeitsleben erforderlich gewesen wäre!) galt er als in Einheit getreten mit der Kirche der neuen Landesherren. Auch die Lateiner, die es auf seinem Territorium gab, galten dann als Gläubige seiner Diözese. Sooft in der Folgezeit bei Wiederbesetzungen oder bei Neugründungen von Bistümern lateinische Bischofskandidaten zum Zug kamen, amtierten diese ebenso für Lateiner und Griechen, wie es andernorts die griechischen Bischöfe taten. Bald darauf handelten die Kreuzfahrer ähnlich. Nachdem 1098 Antiochien erobert war, unterstellten sie sich zunächst der Jurisdiktion des dortigen Patriarchen Johannes IV. Zu Beginn der Lateinerherrschaft war dieser auf dem ganzen Gebiet des Patriarchats von Antiochien oberster Kirchenführer für Griechen und Kreuzfahrer. (8) Sobald jedoch ein Bischofssitz vakant wurde und der Kreuzfahrerfürst für die Ernennung neuer Bischöfe sorgte, zog er Priester vor, die mit ihm aus dem Abendland gekommen waren, weil dies die Lateinerherrschaft stützte (9). Die neuen lateinischen Bischöfe wurden in ihrer Diözese (wie der Patriarch im gesamten Patriarchat) zuständig für Griechen und Kreuzfahrer, und man beachte, dass sie zusammen mit den bisherigen griechischen Bischöfen Mitglieder der einen, gemeinsamen Synode des antiochenischen Patriarchats wurden. Nach der Eroberung Jerusalems und Konstantinopels geschah Ähnliches. Gemäß heutigen Denkgepflogenheiten könnten Lateiner und Griechen nicht einfach zusammengefügt werden, weil die einen als eine "katholische Kirche" und die anderen als eine von ihnen grundsätzlich getrennte "orthodoxe Kirche" gelten. (10) Daher erscheint das Verhalten der Normannen und der Kreuzfahrer manchen heutigen Zeitgenossen als "Zwangskonversion der Griechen zum Katholizismus" oder zumindest als ihr "Abgedrängt-Werden in ein Katakombendasein". Damalige Zeitgenossen und die Konzilsväter des 4. Laterankonzils hatten aber ein Verständnis vom Schisma zwischen Griechen und Lateinern, das ermöglichte, was heute unverständlich erscheint. 2) Das Konstantinopeler Konzil von 879/80 hatte bereits in ähnlicher Weise Stellung bezogen Lange vorher hatte es bereits eine vergleichbare Konzilsentscheidung gegeben, als 879/80 in Konstantinopel eine lateinisch-griechische Synode im Auftrag der Kirchen die Vorwürfe prüfte, die wechselseitig erhoben worden waren. Nach intrigenreichen Vorgängen war 858 der Konstantinopeler Patriarch Ignatios abgesetzt worden. An seiner Stelle wurde Photios, ein hochgebildeter Mann, der bisher Laie gewesen war, gewählt und aus dem Laienstand sofort in den Patriarchenrang erhoben. Die Partei der Zeloten (11) protestierte gegen die Absetzung des bei ihnen beliebten Ignatios, und Papst Nikolaus I. ergriff ihre Partei, denn nach römischem Brauch war es unerhört, einen Laien ohne Erfahrung im klerikalen Dienst sofort zum Bischof oder gar zum Patriarchen zu erheben. Nikolaus meinte, dass die römische Norm auch in Konstantinopel gut wäre, und verlangte die Absetzung des Photios und die Wiedereinsetzung des Ignatios. Als Antwort schrieb Photios eine Reihe polemischer Briefe, darunter seine bekannte Enzyklika an die östlichen Patriarchen. Dank seiner Gelehrsamkeit konnte er zahlreiche Verschiedenheiten zwischen den griechischen und den lateinischen Bräuchen aufzählen und sie als "Abweichungen" der Lateiner von der wahren Lehre und von den heiligen Riten der Griechen deuten. Hatte es Papst Nikolaus den Byzantinern zum Vorwurf gemacht, dass sie nicht den Normen der Römer folgten, so griff nun Photios die Lateiner an wegen ihrer besonderen Formulierungen für den gemeinsamen Glauben, wegen ihrer Disziplin und wegen ihrer gottesdienstlichen Bräuche. (12) Nach einer Absetzung des Photios durch den Kaiser im Jahr 867, nach einer Synode von 869/70 mit römischen Legaten, die den abgesetzten Photios auch noch verurteilte, und nach der Wiedereinsetzung des Photios ins Patriarchenamt im Jahr 877 kam es 879/80 in Konstantinopel zu einer weiteren Synode, an der wieder römische Legaten teilnahmen. Diese Synode bestätigte den Grundsatz, dass jeder Patriarchalsitz die alten Gewohnheiten seiner Überlieferung beibehalten solle, die Kirche von Rom ihre eigenen Gewohnheiten, die Kirche von Konstantinopel die ihrigen, ebenso die orientalischen Throne. (13) Der Ausgang der Ereignisse von 879/80 bekundet das in der damaligen Christenheit noch geläufige Wissen, dass es in der Kirche Verschiedenheit braucht; er versieht uns auch mit Beurteilungskriterien für die Lektüre der antirömischen Polemik des Photios aus der Zeit vor 869/70. Denn wir lernen begreifen, dass Photios den Vorwürfen an die Lateiner nur untergeordnete Bedeutung beigemessen hatte. Einem neuzeitlichen Leser, der seine Darlegungen mit der apologetischen Literatur der letzten 200 Jahre vergleicht, könnte es wegen gewisser Ähnlichkeiten des Wortlauts scheinen, dass seine Ausführungen zumindest hinsichtlich der wichtigeren Streitpunkte in gleicher Weise wie die neuzeitlichen Texte eine grundsätzliche Verwerfung der römischen Lehren und Gepflogenheiten darstellten. Ein solches Verständnis kann jedoch bei ihm nicht vorgelegen haben. Denn anders als die Konfessionalisten der Neuzeit hielt er die gerügten "Verirrungen" für kompatibel mit der Kircheneinheit. Die Römer "verbesserten" in keinem einzigen Punkt, was ihnen Photios vorgeworfen hatte. Dennoch behielt dieser die Kirchengemeinschaft mit ihnen bis an sein Lebensende bei. Er bewertete die gerügten "Verirrungen" der lateinischen Kirche ebenso als "möglicherweise problematisch", aber nicht als Verrat an der wahren kirchlichen Überlieferung, wie Jahrhunderte später das 4. Laterankonzil die griechischen Kirchenbräuche ebenfalls nicht gerne mögen, aber sie tolerieren wird. 3) Das Konzil von Ferrara/Florenz bezieht Stellung Im Lauf der Jahrhunderte wurde dem Urteil über die Verschiedenheit zwischen den lateinischen und den griechischen Kirchen, das Photios und das 4. Laterankonzil vorgelegt hatten, von immer mehr Theologen widersprochen. Darum stellte man im 15. Jahrhundert den Vätern des Florentiner Konzils die Aufgabe, in aller Ausführlichkeit zu prüfen, ob den wechselseitigen Vorwürfen zwischen Griechen und Lateinern echte Glaubensunterschiede zugrunde lägen (das heißt: ob es Gegensätze von solchem Gewicht wären, dass sie den Fortbestand einer Trennung notwendig machen). Nach Beratungen, die etwa ein Jahr in Anspruch nahmen, kamen die Konzilsväter zu dem Ergebnis, dass das kirchliche Erbe von Lateinern und Griechen gleichermaßen rechtgläubig ist. Nachdem sie die wechselseitigen Vorwürfe lange und gründlich überprüft und auch erwogen hatten, was die Kirchen trotz aller Verschiedenheit verband, hielten sie es für richtig, die Gemeinschaft zwischen Griechen und Lateinern zu erneuern, und betrachteten es als ihre Pflicht, unverzüglich das ihnen Mögliche zu tun, um das Schisma zu beenden. Sie fassten einen Beschluss, der zur Wiederaufnahme der Kirchengemeinschaft hätte führen sollen. In den Einleitungsworten des Beschlusstextes brachten sie ihre große Freude über die erlangte Einsicht zum Ausdruck und schrieben: "Freuen sollen sich die Himmel, und es frohlocke die Erde, denn die Mauer, welche die westliche und östliche Kirche trennte, ist beseitigt, zurück kehrten Friede und die Eintracht. Nun hat jener Schlussstein Christus, der aus beiden eins machte, durch das starke Band der Liebe und des Friedens beide Wände verbunden, er vereint sie und hält sie durch die Liebe ewiger Einheit zusammen. So erstrahlte nach jener großen Finsternis der Verzagtheit und nach dem abgrundtiefen Dunkel, das durch die lange Spaltung bedingt war, für alle das heitere Licht der ersehnten Einheit. Freuen soll sich auch die Mutter Kirche, denn sie sieht ihre Kinder, die bisher untereinander uneins waren, nunmehr zu Einheit und Frieden zurückkehren; sie, die zuvor wegen ihrer Trennung bitterlich weinte, danke aufgrund ihrer jetzigen wunderbaren Einheit dem allvermögenden Gott mit unaussprechlicher Freude. Alle Gläubigen auf dem ganzen Erdkreis sollen sich mitfreuen und alle, die den Namen Christi tragen, zusammen mit der Mutter, der katholischen Kirche, frohlocken." Die langen Diskussionen der Konzilsväter waren aber ausschließlich im geschlossenen Kreis erfolgt. Bedauerlicherweise hatten die Konzilsteilnehmer nicht bedacht, dass die Aussöhnung zwischen ihren Kommunitäten die beiderseitige öffentliche und kommunitäre Annahme jener Einigung voraussetzt, die im Sitzungssaal beschlossen worden war. Sie bedachten nicht, dass seit dem 7. ökumenischen Konzil ein großer Wandel vor sich gegangen war, weil es keinen Kaiser mehr gab, der über die Kirchen lateinischer und über die Kirchen griechischer Tradition herrschte (14) und durch seine Machtmittel dafür Sorge hätte tragen können, dass die Beschlüsse der ökumenischen Konzilien überall Annahme fanden. (15) Da sie diesen Wandel nicht beachteten, erfassten sie auch nicht, dass es in der neuen historischen Situation nicht mehr wie einst bei den ökumenischen Konzilien des ersten Jahrtausends genügen konnte, Beratungen abzuhalten, Beschlüsse zu fassen und sich für deren Durchsetzung auf den Kaiser zu verlassen. Nunmehr hätten sie selber für die Rezeption der Ergebnisse Sorge tragen müssen. Unter den Gegebenheiten des 15. Jahrhunderts wäre auf beiden Seiten in den Gemeinden ein pastorales Mühen der Hierarchen um breite Zustimmung zu den Resultaten der konziliaren Beratungen notwendig gewesen. Weil es keine staatliche Hinführung zu ihrer Annahme geben konnte, hätte kirchlicherseits Sorge getragen werden müssen, dass es auf beiden Seiten zu einer besseren und allgemein verbreiteten Kenntnis von den wirklichen Sachverhalten gekommen wäre. Die zahlreichen Vorurteile und die verbreiteten Missverständnisse hätten in Predigt und Katechese bekämpft werden müssen, damit der lange, in vielen Kreisen sehr ausgiebig kolportierte Verdacht, die Verschiedenheit zeuge von unüberbrückbaren Gegensätzen, abgelöst worden wäre durch eine Zustimmung zu der besseren Einsicht, die von den Konzilsvätern mühsam erarbeitet worden war. Doch die Konzilsväter beider Seiten versäumten es, sich um ein Verbreiten korrekter Kenntnisse bei der Mehrheit von Klerus und Volk zu kümmern. Sie hielten die Dokumente, welche ihre elitäre Einsicht in die Kompatibilität der abendländischen und der morgenländischen kirchlichen Tradition zum Ausdruck brachten, und ihren kirchenrechtlich korrekt gefassten Beschluss, die Einheit herbeizuführen, für allein schon ausreichend. 4) Das Konzil von Trient und die Griechen Das Trienter Konzil, das 1545-1563 gefeiert wurde, wird in der Regel für ein rein abendländisches Konzil gehalten. Dafür beruft man sich einerseits auf die Tatsache, dass seine Thematik von innerabendländischen Problemen, nämlich von der Auseinandersetzung mit der Reformation, bedingt war, und andererseits auf seine Zusammensetzung, die sich klar unterschied von jener des Konstanzer und des Florentiner Konzils, welche "schismatische" Griechen zu vollberechtigten Teilnehmern hatten. Zwar gab es auch beim Tridentinum Teilnehmer aus dem Osten, aber sie waren entweder Lateiner aus den venezianischen Kolonien oder Griechen von dort, die einen Lateiner zum Metropoliten hatten und gemäß den Beschlüssen des 4. Laterankonzils als uniert mit der lateinischen Kirche galten. Theobald Freudenberger hebt jedoch hervor, dass Pius IV., der Papst der dritten Sitzungsperiode, "weder Mühe noch hohe Kosten (gescheut habe), um auch Vertreter der schismatischen Kirchen des Ostens nach Trient zu bringen". (16) Doch infolge der damaligen politischen Lage blieben seine Einladungen erfolglos. Beim Bedenken des Themas "das Tridentinum und die Griechen" (17) müssen vor allem zwei Dinge beachtet werden. Erstens hat das Tridentinum in ausführlichen Diskussionen peinlich darauf geachtet, die Verwerfung der protestantischen Eheauffassung so zu formulieren, dass zusammen mit ihr nicht auch die griechische Praxis in der Ehepastoral, die sich entschieden von jener der Lateiner unterscheidet, verurteilt wurde, (18) und zweitens erstrebten die Päpste des Tridentinums die volle Teilnehmerschaft östlicher "Schismatiker". Die besondere Bedeutsamkeit gerade der zweiten Tatsache ergibt sich aus einem Vergleich mit dem 2. Vatikanischen Konzil. Denn ausgerechnet bei diesem Konzil, das die Öffnung der katholischen Kirche für das Gedankengut der ökumenischen Bewegung brachte, hielten Katholiken und Orthodoxe das Mittun von "Schismatikern" als Konzilsväter nicht mehr für möglich. Sie meinten, dass orthodoxe Bischöfe und Theologen an einem vom Papst einberufenen Konzil nur als Beobachter teilnehmen könnten, weil zu diesem Zeitpunkt die unterschiedlichen Frömmigkeits- und Erkenntnisentwürfe beider Seiten für Glaubensunterschiede gehalten wurden. Wegen des bestehenden Schismas galt im 20. Jahrhundert als unvollziehbar, was päpstlicherseits im 16. Jahrhundert, in dem nach allgemeiner Meinung der Zeitgenossen ebenfalls ein Schisma bestand, nicht nur möglich, sondern sogar als Ergänzung erwünscht war. Also muss sich in der Zeit, die zwischen dem Tridentinum und dem 2. Vatikanischen Konzil verstrich, das Verhältnis zwischen Griechen und Lateinern und das Verständnis von dem, was man als "Schisma" bezeichnet, gründlich geändert haben. (19) Die Grenze zwischen Katholiken und Orthodoxen nannte man damals genauso wie heute ein "Schisma", doch zur Zeit des Tridentinums war eben das, was "Schisma" geheißen hatte, weniger grundsätzlich als das, was man im 20. Jahrhundert und auch heute noch unter "Schisma" versteht. Logischerweise ergibt sich aus dem Gesagten: Es kann nicht sein, dass jenes Schisma, welches zur Zeit des 2. Vatikanischen Konzils die Katholiken von den Orthodoxen trennte (und sie bis auf den heutigen Tag weiterhin voneinander trennt) schon zur Zeit des Tridentinums bestanden hätte; noch viel unsinniger ist die Behauptung, dass eben jenes Schisma, das zur Zeit des 2. Vatikanischen Konzils bestand und bis heute besteht, zur Zeit des Tridentinums schon ca. ein halbes Jahrtausend alt gewesen wäre. Es muss Unsinn sein, denjenigen zuzustimmen, die meinen, dass sich der entscheidende Bruch zwischen den latenischen und den griechischen Kirchen zu Beginn des 2. Jahrtausends ereignet habe. 5) Zustimmung und Ablehnung für die Ergebnisse des Konzils von Ferrara/Florenz anlässlich der Brester Union Bald nach dem Tridentinum kam es zur Brester Union, zu einem von jenen Ereignissen, die das Verhältnis zwischen Katholiken und Orthodoxen am schwersten belasten. Bei seiner Vorbereitung sollte nochmals ein lebhaftes Zeugnis dafür abgelegt werden, dass das traditionelle Verständnis vom Schisma zwischen Griechen und Lateinern zumindest auf Seiten der Ruthenen immer noch fortbestand. Unter dem Datum vom 2.12.1594 erstellten ruthenische Bischöfe ein Dokument und trugen Sorge dafür, dass es in Kürze die Unterschriften fast aller Synodalen der Kiever Metropolie erhielt. (20) Darin formulierten die Unterzeichner die Ablehnung des Zwistes mit den lateinischen Christen mit Worten, die besondere Beachtung verdienen, weil sie gegenwärtig weder von katholischen, noch von orthodoxen Bischöfen wiederholt werden könnten. Die Unterzeichner bedauerten nämlich, dass die Gläubigen der Lateiner und jene ihrer eigenen Kirche "obgleich ein und demselben Gott angehörend und als Söhne einer und derselben heiligen katholischen Kirche getrennt sind, weswegen wir uns gegenseitig keine Hilfe und Unterstützung angedeihen lassen können". Sie schlossen ihr Dokument ab mit dem Vermerk, dass das Bewahren aller geistlichen Überlieferungen Bedingung sei für die ersehnte Union. Sie gingen davon aus, dass dabei das gesamte östliche Herkommen ihrer Metropolie, somit auch ihre sakramentale Communio mit den Schwesterkirchen östlicher Tradition jenseits der Grenzen Polens (21) und die Handlungsfähigkeit ihrer autonomen Synode, erhalten bleibe. Damit erwiesen sie sich ganz dem Geist des Florentiner Dekrets "Laetentur coeli" verpflichtet, das die kirchlichen Überlieferungen von Griechen und Lateinern als rechtgläubig und in ihrer Verschiedenheit als nebeneinander berechtigt anerkannt hatte. (22) In einer Situation, in der die Staatsmacht nicht einmal ihrer Kirche angehörte, begingen sie jedoch ebenfalls den Fehler der Väter von Florenz, dass sie nur unter sich berieten und weder beim Klerus, noch bei den Gläubigen um die Verbreitung ihrer Einsichten bemüht waren. Nicht einmal auf die Vergewisserung waren sie bedacht, dass auch die Partner in Rom, mit denen sie einig werden wollten, derselben Auffassung anhingen. (23) Darum hob mit den beiden Synoden von Brest des Jahres 1596 eine sehr leidvolle Geschichte an. 6) Exkurs zum theologischen Dialog zwischen Katholiken und Orthodoxen in der Gegenwart Hier drängt sich ein Exkurs in die Gegenwart auf. 1980 eröffneten die katholische und die orthodoxe Kirche einen offiziellen theologischen Dialog, dem sie die nämliche Aufgabe stellten, den das Konzil von Florenz erhalten hatte. Eine gemischte internationale Kommission von Hierarchen und Theologen wurde eingesetzt. Diese hat ihre Arbeiten zwar noch nicht abgeschlossen, mühte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten aber mit beachtlichem Erfolg um das Zusammentragen der Einsichten beider Seiten in die Ekklesiologie und in die Bedeutung der heiligen Sakramente für das Heil der Menschen. Die von ihr inzwischen erreichten Resultate sind bereits veröffentlicht. (24) Traurig stimmt, dass sich in beiden Kirchen die Verantwortlichen wenig mühen, dafür bei Klerus und Gläubigen Interesse zu wecken. Falls sich dies nicht ändert, könnte es sein, dass wie in den Tagen des Patriarchen Photios, nach dem 4. Laterankonzil, nach dem Florentinum, nach dem Tridentinum, nach den Beratungen der Synodalen der Kiever Metropolie und nach anderen Vorgängen, die in dem kurzen Beitrag nicht allesamt dargelegt werden können, die Resultate der theologischen Forschung wieder missachtet werden. Dann bahnte sich in den Kirchengemeinschaften betrüblicherweise wegen fortdauernder Unkenntnis von den wahren Verhältnissen ein neuer Fall von Nicht-Rezeption erlangter Einsichten in die Kompatibilität der Traditionsströme an. 7) Vor dem Konzil von Ferrara/Florenz litten die Lateiner unter einem schweren Schisma, vor der Brester Union und auch gegenwärtig waren bzw. sind die "griechischen Kirchen" von Schismen betroffen. Kehren wir zurück zu den historischen Überlegungen. Um die ekklesiologische Beurteilung von Schismen bei Lateinern des Spätmittelalters (und der beginnenden Neuzeit) nachzuvollziehen, gilt es auch zu bedenken, dass die abendländische Kirche, als das Florentinum tagte, die Zeit noch nicht endgültig hinter sich hatte, in der sie wegen zweier bzw. dreier Päpste in Schismen gespalten war. Die Papstparteien, zwischen denen keine Communio bestand, wurden - und werden bis heute in den Handbüchern der Kirchengeschichte - miteinander als die eine abendländische Kirche, nicht als voneinander abgehobene Kirchen behandelt. Denn es war zwischen ihnen zu keinen doktrinären Verurteilungen gekommen; nur die Kirchenleitung war gebrochen. Um die Lage wieder zu heilen, gab es Gespräche über die Schisma-Grenzen hinweg. Als die Gespräche erfolgreich waren, galten die Gräben als zugeschüttet. Niemand sprach damals oder spricht heute von Konversionen, wenn er vom Ende der Papstschismen berichtet. Auch in der ostslawischen Christenheit hatte es bis kurz vor der Brester Union ein Schisma gegeben, das keine doktrinären Gründe hatte, sondern wegen kanonischer Unregelmäßigkeit in der Kirchenleitung ausgebrochen war. Es hatte begonnen, als man in Moskau 1448 ohne Zustimmung des Konstantinopeler Patriarchen Bischof Iona von Rjazan zum Metropoliten von Kiev und der ganzen Rus' wählte, beziehungsweise als man 1461 ohne Rückfrage in Konstantinopel dessen Nachfolger den Titel eines Metropoliten von Moskau beilegte und die Kiever Metropolie spaltete. Erst 1589 - also erst nach weit über 100 Jahren - ordnete Patriarch Jeremias die Verhältnisse wieder, indem er der Moskauer Kirche die Zustimmung der Griechen zu der von ihnen einst eigenmächtig in Anspruch genommenen Autokephalie vermittelte. Auch bei dieser Rückkehr zur Kanonizität bedurfte es keiner Konversionen. War im Mittelalter das Verhältnis zwischen Griechen und Lateinern - abgesehen von der Dauer der Schismen - ein anderes als jenes
Wie die Anhänger der verschiedenen Päpste hatten sich auch Griechen und Lateiner auseinandergelebt. Wie zwischen den Papstparteien und zwischen der kanonischen und der nichtkanonischen Orthodoxie der Gegenwart gab es auch zwischen Lateinern und Griechen nichts, wodurch empirisch erfahrbar geworden wäre, dass ihr Eins-Sein im Heiligen Geist die Entfremdung überdauerte. Aber auch wechselseitige kirchliche Aburteilungen hatte es nicht gegeben. Die Artikulation von Gegnerschaft, zu der es zwischen Griechen und Lateinern oft genug kam, hatte nie amtlichen kirchlichen Charakter; sie war die persönliche Auffassung von Theologen beziehungsweise eine Ablehnung des Fremdartigen am kirchlichen Leben der anderen durch das breite Kirchenvolk. In allen Fällen aber, in denen es zu kirchenamtlichen Untersuchungen gekommen war, hatte sich die Kompatibilität der lateinischen mit den griechischen Traditionen ergeben. Die besondere Art der durch Reformation und Altgläubigentum 1) Die Reformation brachte keine Bereicherung der lateinischen Kirche durch Einsichten von Schwesterkirchen mit eigenständigen Traditionen, sondern schied im abendländischen Traditionsstrom zwischen Elementen, die den Reformatoren weiter als legitim, und anderen Elementen, die ihnen als illegitim galten. Auf einem weit mehr als tausendjährigen Traditionsstamm formten sich Äste, und das bisher Gemeinsame wurde getrennt fortgeführt. Es kam zu Konfessionen, die sich voneinander unterscheiden, weil die einen mehr, die anderen weniger vom alten Erbe weiter pflegen und weil sie das, wofür sie optierten, in unterschiedlicher Weise akzentuieren. Die katholischen Kontroverstheologen gerieten in Sorge, dass bei den Protestanten Unverzichtbares verloren gegangen sei, während die protestantischen Kontroverstheologen besorgt sind, dass das Festhalten der Katholiken am Herkommen das Evangelium verdunkle. Katholiken, welche die Frömmigkeit und die Lehren der Protestanten mit ihrem eigenen kirchlichen Leben in Beziehung setzen, haben nicht "über den Tellerrand der abendländischen Tradition hinauszuschauen", um sich durch Schwesterkirchen ergänzen und bereichern zu lassen. Vielmehr haben sie sich dagegen zur Wehr zu setzen, dass allerlei von dem, was sozusagen "auf dem Teller der lateinischen Kirche gelegen hatte", durch die Reformatoren unter Protest ausgesondert und abgelehnt wurde. Beim Blick über die Gräben der neuen Schismen geht es nicht um Bereicherung der Überlieferung des Abendlands durch eigenständige apostolische Traditionen, sondern um die Abwehr von Abstrichen an dieser Tradition, allenfalls auch um ein deutlicheres Erkennen einzelner Züge an ihr dank der von der Reformation erreichten neuen Akzentuierungen. 2) Die Reformation warf der lateinischen Kirche des Abendlands vor, das zu wahrende apostolische Erbe zu weit zu fassen und zu viele Züge für heilig zu halten; im Osten erhob das Altgläubigentum gegen die Kirche byzantinischer Tradition den gegenteiligen Vorwurf, dass sie auf das Wahren des heiligen apostolischen Erbes zu wenig Eifer verwende. In beiden Fällen hatten es die Apologeten mit Gegnern aus den eigenen Reihen zu tun, und sie hatten um die Frage zu ringen, wie der Umfang dessen, was ihre Kirche von den Vorvätern ererbt hatte, in gebührender Weise zu bewahren sei. In der Abwehr, die ihrer Kirche gegen solche Gegner aufgenötigt wurde, geht es um kein "Zusammenfassen zur reicheren Erkenntnis", sondern um das Garantieren bzw. um die Grenzen eines abstrichlosen Bewahrens des eigenen Herkommens. 3) Die Auseinandersetzung mit den neuen Gegnern beanspruchte viel Aufmerksamkeit, da diese im eigenen Land lebten. So blieb man in der Folgezeit an den theologischen Schulen des Abendlands fast nur mehr auf das kirchliche Leben von abendländischer Art (auf das katholische und auf das daraus hergeleitete protestantische) bedacht; für ein Befassen mit den Frömmigkeits- und Erkenntnisentwürfen von Kirchen anderer Tradition in fernen Ländern mangelten Zeit und Interesse. Im Osten war das Schulwesen um diese Zeit überhaupt recht schwach. Auf beiden Seiten machte sich Unkenntnis vom christlichen Leben "der anderen" breit. Missverständnisse und Fehldeutungen waren die Folge, und das Wissen um die ursprüngliche Eigenständigkeit der östlichen und der westlichen Überlieferungen verlor sich. Als schließlich 1729 die römische Kongregation für die Glaubensverbreitung jegliche "communicatio in sacris" (d.h. alles gemeinsame Beten, alle gemeinsamen Gottesdienste und jegliches wechselseitiges Anteilgeben und Anteilnehmen an den heiligen Sakramenten) zwischen Gläubigen, die sich zum Papst bekannten, und solchen, die dies nicht taten, verboten hatte, und als die griechischen Patriarchen 1755 in Antwort darauf die lateinischen Christen den Heiden gleichgestellt und sie für ungetauft erklärt hatten, kam im Lauf des 18. Jahrhunderts ein neues Bewusstsein vom wechselseitigen Verhältnis zwischen Griechen und Lateinern auf. Lateiner und Griechen verstehen sich seither nicht mehr als Schwesterkirchen, die sich ergänzten, falls ihre Communio nicht gestört wäre, sondern als zwei einander fremde und voneinander im Glauben getrennte Konfessionen. (25) Der lateinsche Westen gewöhnte sich im Lauf dieser Entwicklung daran, die Kirchen byzantinischer Tradition wie eine Art Protestantismus zu verstehen, der sich irgendwann in der Vorzeit von der ursprünglichen Gemeinsamkeit abgetrennt habe, und man verbohrte sich in die Ansicht, die orthodoxe Welt und der lateinische Westen hätten sich wie Katholiken und Protestanten wegen irgendwann aufgebrochener Meinungsunterschiede in zwei gegensätzliche Ströme geteilt. Orthodoxe Apologeten, welche sich des alten Eigenstands der Traditionen ebenso wenig bewusst blieben wie die westlichen, stimmten im Wesentlichen zu, nur hielten sie die westliche Christenheit für verantwortlich an dem Bruch. Ohne Beachtung der historischen Daten und der Denkweisen der früheren Generationen setzte man willkürlich auch ein Datum fest, zu dem dies geschehen sein soll. So wurde der unglückselige Mythos von einem sogenannten "großen Schisma" geboren. Der Mythos von einem sogenannten "großen Schisma" als Hindernis 1) Als im 19. Jahrhundert der Mythos vom sogenannten "großen Schisma" geboren war, hielt man sich zunächst für berechtigt, Patriarch Photios für den Schuldigen daran zu halten, und nach dem Vorbild älterer Ketzerbezeichnungen wie Arianer, Nestorianer, Lutheraner oder Kalviner nannte man die Orthodoxen in kirchengeschichtlichen oder konfessionskundlichen Darlegungen des 19. Jahrhunderts gern Photianer. Auch in offiziellen Texten geschah dies, z.B. in einem Hirtenbrief des Pariser Erzbischofs Sibour zur Zeit des Krimkriegs (26) oder noch 1933 im Vorwort einer von der römischen Kurie veröffentlichten Liste der katholischen Titularbistümer. (27) Nachdem die Kirchengeschichtsforschung jedoch bekannt gemacht hatte, dass Photios mit dem Papst keineswegs im Schisma verblieb, sondern in seiner zweiten Amtszeit und bis an das Lebensende mit ihm in Communio stand, musste davon abgerückt werden. Weil man also Photios nicht mehr zum Sündenbock nehmen konnte, entschloss man sich, die Ereignisse des Jahres 1054 - ohne Beachtung der vielen Schismen, die es vorher gegeben hatte (28), und der zahlreichen Fakten von Gemeinsamkeit nachher (29) - zum angeblichen "Anfangsdatum" und Patriarch Michael Kerullarios sowie Kardinal Humbert zu den "Schuldigen" zu erklären. 2) Wie eingangs bereits zitiert ist, zeigt das Ökumenismusdekret des 2. Vatikanischen Konzils auf, dass wegen der Verschiedenheit der Mentalitäten und Lebensweisen bei den zum Heil berufenen Menschen das Samenkorn des Wortes Gottes von Anfang an verschieden aufgenommen wurde und vielgestaltige Formen von kirchlichem Leben heranwachsen ließ. Ferner legt es dar, dass die Kirchengeschichte zweierlei Arten von Spaltungen kennt: die eine Art ereignete sich, nachdem wegen des Geringer-Werdens von Verständnis und Liebe füreinander das wechselseitige Sich-Anerkennen zwischen den unabhängig voneinander herangewachsenen Traditionsströmen verdrängt wurde durch gegenseitiges Sich-Verurteilen; zur anderen Art kam es, weil sich irgendwann innerhalb eines Traditionsstroms schwere Widersprüche ergaben, die dazu führten, dass der Strom sich in zerstrittene Teile spaltete. Die deutlichen Ausführungen über die Verschiedenheit der Spaltungen werden aber vielfach noch immer übergangen. Denn es macht weniger Mühe, Geschehnisse in ferner Vergangenheit nach dem Modell näher liegender Vorgänge zu interpretieren, als sich in die Ereignisse und Denkstrukturen weniger bekannter Welten hineinzutasten. Im deutschen Sprachraum und in den meisten Handbüchern zur Kirchengeschichte unterlässt man es in der Regel, die Eigenart der ostkirchlichen Traditionsströme genauer zu studieren, und macht statt dessen die innerabendländische Spaltung in Katholiken und Protestanten schlichtweg zum Modell für das Interpretieren aller sonstigen Kirchenspaltungen. Dabei übergeht man den Umstand, dass zwischen Ost und West nie ein eben solcher Gleichklang bestanden hatte, wie ihn das vorreformatorische Abendland kannte; statt dessen wird, wie z.B. neuerdings in der Neuauflage des Herder-Atlasses zur Kirchengeschichte von 1987, postuliert, dass bis zu jenem Zeitpunkt, den man "das große Schisma" nennt, Lateiner und Griechen ebenso einen gemeinsamen Stamm gebildet hätten wie bis zur Reformation die Kirche des Abendlandes. (30) 3) Verschiedene Krankheiten kann der Arzt nicht durch dieselben Medikamente heilen. Ebenso wäre es ein Unding, sich bei der Suche nach dem sichtbaren Ausdruck für die Einheit zwischen den Christen östlicher und westlicher Tradition jener Verfahrensweisen bedienen zu wollen, die beim katholisch-protestantischen Dialog die richtigen sind. In der lateinischen Welt folgte auf eine mehr als tausendjährige Gemeinsamkeit des kirchlichen Lebens wegen bestimmter Widersprüche, welche die innerabendländischen Schismen zur Folge hatten, eine nicht einmal halb so lange Periode der Verästelung. Nun gilt es, das Zusammenfinden wieder zu erstreben, indem die gegenwärtigen Teile der Kirche des Abendlandes einander wieder näher gebracht werden durch eine "Versöhnung der Verschiedenheiten". In ihrer erneuerten Einheit mögen sie dann einander auf Grund der Akzentuierungen, die sie im konfessionellen Streit erlangten, manche bessere Einsicht in bestimmte Einzelaspekte der ihnen gemeinsamen römisch-lateinischen Tradition vermitteln. Da hingegen nicht Widersprüche, sondern das Geringer-Werden des Verständnisses und der Liebe füreinander für die Schismen zwischen den von jeher verschiedenen östlichen und westlichen Kirchen Anlass gaben, lassen sich diese Kirchen nicht durch "Versöhnung der Verschiedenheiten" aufeinander zuführen; bei ihnen bedarf es des Wiederbelebens der ursprünglichen "Anerkennung der Verschiedenheit". Damit weiterhin die Katholizität und die Apostolizität der Kirche gewahrt werde, müssen ihre Frömmigkeits- und Erkenntnisentwürfe in voller Verschiedenheit erhalten bleiben, und ihr Nebeneinander soll der Gesamtkirche weiterhin zu der eingangs gezeichneten "reicheren Erkenntnis" verhelfen. Wird dies in Hinkunft nicht viel entschlossener als bislang beachtet, bleiben die Schismen zwischen Ost und West weiter bestehen. 4) Zum Abschluss sei noch vermerkt, dass hier die historische Beweisführung zwar nur für das Verhältnis zwischen Griechen und Lateinern vorgelegt wurde; mutatis mutandis gilt das Dargelegte aber für das Verhältnis zu den Altorientalen ebenfalls. (31) -------
|
Grundlegend dazu zwei ausführliche Darstellungen von
Ernst Christoph Suttner,
Ökumenische Wegzeichen,
Institut für Ökumenische Studien,
Université Miséricorde,
CH-1700 Fribourg:
Das wechselvolle Verhältnis
zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens.
Ökumenische Wegzeichen 11, 2002.
Schismen, die von der Kirche trennen,
und Schismen, die von ihr nicht trennen.
Ökumenische Wegzeichen 15, 2003.